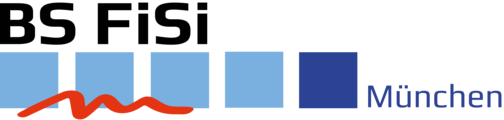zuständiger Lernfeldbeauftragter: Herr Joachim Wolf
Im 3. Ausbildungsjahr setzt sich das Fach IT-Systeme aus den Lernfeldern 10b und 11b KMK-Rahmenlehrplans zusammen.
In Lernfeld 10b setzen sich die Auszubildenden mit den grundlegenden technischen Eigenschaften von Betriebssystemen und Virtualisierung auseinander. Sie führen Administrationsaufgaben durch und lernen, Serverdienste gemäß den Anforderungen ihrer Kunden auszuwählen und zu konfigurieren. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Automatisierung von administrativen Prozessen durch Shell-Skripte. Dabei informieren sich die Auszubildenden über verschiedene Serverdienste wie SAMBA oder Webserver sowie Plattformen wie Windows, Linux, Docker, Proxmox und VirtualBox. Sie planen, konfigurieren und implementieren diese Dienste unter Berücksichtigung von betrieblichen Vorgaben und Lizenzierungen. Zudem wenden sie Testverfahren an und optimieren die Automatisierung von Prozessen, um diese effizient und fehlerfrei umzusetzen.
Durch diese praxisorientierte Herangehensweise erwerben die Auszubildenden fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihnen nicht nur in der täglichen Administrationsarbeit, sondern auch bei der Lösung komplexer Aufgabenstellungen im IT-Bereich zugutekommen.
Die Auszubildenden
- informieren sich über Serverdienste sowie Plattformen (Welche Serverdienste und welche Plattformen gibt es? (Welche Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Vorteile und Nachteile haben diese?)
- wählen Plattformen und Serverdiensten auf Basis von Kundenanforderungen aus (Was will der Kunde machen und mit welchen Diensten oder Plattformen kann das Vorhaben realisiert werden?)
- berücksichtigen bei den Kundenanforderungen die Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Administrierbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit
- planen die Konfiguration der Dienste mittels Konzept
- berücksichtigen die Einrichtung, Aktualisierung, Datensicherung und Überwachung im Konzept
- implementieren die Dienste (Berücksichtigung von betrieblichen Vorgaben sowie Lizenzierungen)
- entwickeln Testverfahren,
- überwachen die Diensten und
- erarbeiten Lösungsvorschlägen für den Kunden bei kritischen Zuständen (Wie kann der Dienst getestet und überwacht werden? Was kann der Kunde bei kritischen Zuständen machen, um den Dienst wieder lauffähig zu machen?)
zuständiger Lernfeldbeauftragter: Herr Joachim Wolf (wo@bsfisi.eu)
In diesem Lernfeld steht der Betrieb und die Sicherheit von vernetzten Systemen im Mittelpunkt. Die Auszubildenden erweitern ihre Kompetenzen im Bereich der IT-Sicherheit. Sie lernen im Unterricht die typischen sicherheitstechnischen Herausforderungen und die entsprechenden Lösungsansätze kennen und erlangen so detaillierteres Wissen über den Sicherheitsmanagement-Prozess. Zudem beschäftigen sich die Auszubildenden mit konkreten informationssicherheitstechnischen Problemen und erarbeiten Lösungsansätze dazu. Dabei beachten sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den Datenschutz. Zuletzt beurteilen sie den Schutzbedarf einzelner Schutzziele, führen gegebenenfalls eine Risikoanalyse durch und schlagen die nötigen technischen sowie organisatorischen Maßnamen vor. Im Unterricht legen wir Wert auf die Risikoermittlung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Risikominimierung. Auch die Bewertung der Risiken, die Erstellung von dazugehörigen Dokumentationen und Erkenntnisübergabe an den Kunden ist ein Bestandteil dieses Lernfeldes.
Die Auszubildenden
- identifizieren den Shchutzbedarf eines IT-Systems in einem Kundengespräch
- beschäftigen sich mit der Informationssicherheit in vernetzten Systemen
- ermitteln die Schutzziele
- analysieren IT-Systemen hinsichtlich der Anforderungen an die Informationssicherheit und ggf. benennen die Risiken
- planen Vorkehrungen und Maßnahmen zur Minimierung des Schadenfalls unter Berücksichtigung von rechtlichen Regelungen und betrieblicher IT-Richtlinien
- implementieren Maßnahmen unter Berücksichtigung technischer und organisatorischer Rahmenbedingungen
- prüfen die Sicherheit des vernetzten Systems
- bewerten erreichte Sicherheitsniveaus in Bezug auf Kundenanforderung, eingesetzter Maßnahmen und die Wirtschaftlichkeit
- erstellen eine Dokumentation über die Ergebnisse der Risikoanalyse an den Kunde
zuständige Lernfeldbeauftragte: Frau Manuela Frommhold (fh@bsfisi.eu)
In Lernfeld 12b führen unsere Auszubildenden einen Kundenauftrag zur Systemintegration als Projekt durch. Das in den vorherigen Jahrgangsstufen erworbene Fachwissen und wichtige Fähigkeiten, um ein Projekt erfolgreich zu planen und umzusetzen, werden vertieft und erweitert. So führen unsere Projektteams u. a. eine Anforderungsanalyse durch, um Projektziele, Anforderungen und gewünschte Ergebnisse abzuleiten. Sie stimmen sich regelmäßig mit dem Kunden ab, um die Ergebnisse nach Kundenwunsch umzusetzen. Hierbei müssen die personellen, technischen und finanziellen Ressourcen berücksichtigt werden. Auch eine nachvollziehbare Dokumentation ist gefordert. Um erfolgreich in den Teams zu arbeiten, sind Fähigkeiten wie Kooperationsbereitschaft, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und ein hohes Maß an Eigeninitiative und Strukturfähigkeit gefordert. Diese Fähigkeiten werden kontinuierlich gefördert. Eine wichtige Rolle nimmt auch die überzeugende Präsentation der Projektergebnisse vor dem Kunden ein.
Die Auszubildenden
- führen eine Anforderungsanalyse durch
- planen und kalkulieren das IT-Projekt
- entwickeln Lösungsvarianten
- erstellen ein Angebot
- fertigen eine Dokumentation an
- implementieren die ausgewählte Lösung
- präsentieren ihr Ergebnis
zuständige Fachbeauftragte: Frau Kornelia Seiband
Unterrichtsinhalte 3. Ausbildungsjahr
- Arbeitszeugnis
- Projektantrag und Projektdokumentation
- Geschäftliches Anschreiben
- Unternehmensgründung
- Umgang mit Formularen
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Christian Reiner
Unterrichtsinhalte 3. Ausbildungsjahr:
- Regional Studies: Australia, New Zealand, South Africa
- Work & Career
- Job Application (CV, Covering Letter, Job Interview)
- IT-Security
zuständige Fachbeauftragte: Frau Daniela Wittl
Unterrichtsinhalte 3. Ausbildungsjahr:
- Glücksvorstellungen z.B. eigenverantwortliches Glück, Selbstoptimierung
- Sinn des Lebens; Sinnangebote durch Partnerschaft und Familie, Freundschaft, berufliche Tätigkeit, soziales Engagement, Glaube
- Gewaltfreie Kommunikation, Mediation
- Datensammlung und –nutzung, Verfügbarkeit von Informationen, Vernetzung und Kommunikation, z.B. soziale Netzwerke, Erreichbarkeit
- Mögliche Themenfelder: Filterblasen, Fake News, Online-Gewalt, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Profiling
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Dieter Metzmann
Die Auszubildenden setzen sich intensiv mit ihrer Rolle als Verbraucher auseinander. Sie verstehen die Grundlagen und Konsequenzen von Verträgen und erkennen sowohl die Risiken als auch Chancen ihres Konsumverhaltens. Darüber hinaus befassen sich die Auszubildenden mit den Hauptzielen und Instrumente der Wirtschaftspolitik und setzen sich mit den Zielkonflikten auseinander, die in diesem Bereich auftreten können. Ein zentrales Thema ist auch das Verhältnis von Geldwert und Wirtschaftslage, wodurch die einen tiefen Einblick in die Geldpolitik und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft erhalten. Abschließend wird den Auszubildenden bewusst, dass Deutschland ein exportabhängiges Land ist und sie betrachen den Euro als internationales Zahlungsmittel. Dabei erkennen sie europäische Zentralbank als den Garant für Geldwertstabilität.
Unterrichtsinhalte 3. Ausbildungsjahr:
- Verbraucherschutz
- soziale Marktwirtschaft
- magisches Vieleck
- Konjunktur
- Eurozone - EZB
zuständiger Fachbeauftragter ev.: Herr Günter Gottfried
Der Religionsunterricht ist ein Forum für die Fragen, Probleme und Überzeugungen der Auszubildenden. Die Loslösung vom Elternhaus, die Suche nach Orientierung und Lebenszielen sowie das Zurechtfinden in der Gesellschaft, im gewählten Beruf und in religiösen Fragen kennzeichnen die Situation der jungen Menschen während der Berufsausbildung. Im Religionsunterricht suchen sie nach Antworten und verlässlicher Orientierung.
Die Lehrkräfte greifen im Religionsunterricht persönlich bedeutsame Anliegen der Auszubildenden auf und setzen im Unterricht in pädagogischer Verantwortung entsprechende lerngruppenspezifische Schwerpunkte.
Im Zentrum des Unterrichts stehen Fragen, die das gesamte menschliche Dasein umfassen. Die Spannungsfelder menschlichen Lebens mit ihren Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen sollen reflektiert und für eine Sinn- und Handlungsorientierung an der christlichen Botschaft aufgeschlossen werden.
Die Auszubildenden entwickeln – auch in der persönlichen Auseinandersetzung mit ihrer Religionslehrkraft – individuelle, reflektierte und gegenüber anderen verantwortbare Standpunkte und Werthaltungen. Ihre sozialen Kompetenzen festigen sich in der Auseinandersetzung mit anderen Erfahrungen und Positionen innerhalb der Unterrichtsgruppe. Sie lernen eigenständiges, sinnerfassendes und vernetztes Denken, sie schulen ihre religiöse Sprach- und Ausdrucksfähigkeit und üben sich im respektvollen Umgang mit anderen Meinungen.
Der Religionsunterricht ist von einer Atmosphäre der Offenheit, des gemeinsamen Suchens und des lebendigen Gesprächs miteinander geprägt. Sein ganzheitlicher Ansatz bezieht Phasen der Stille, der Kontemplation und der Kreativität mit ein.
Unsere Schule ist Teil des Schulversuchs „StReBe“ (Stärkung des konvessionellen Religionsunterricht an Berufsschulen).
Dieser ermöglicht es, dass evangelische und katholische Auszubildende gemeinsam unterrichtet werden können und öffnet darüber hinaus den Religionsunterricht auch für Menschen anderer Religionen oder Glaubensrichtungen.
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Claus Maier (BS Info)
Profil des Unterrichtsfaches Sport
Sport gehört zu den allgemeinbildenden Fächern an beruflichen Schulen und beinhaltet eine ganzheitlich pädagogische,gesundheitliche und soziale Zielsetzung:
- Spiel und Spaß
- Ausgleich zum Berufsalltag und sitzenden Tätigkeit
- Einsicht über Belastungen und Beanspruchungen der Arbeitswelt
- Individuelles und soziales Lernen
- Schulung des kooperativen Verhaltens
- Sportliche Qualifikation als Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung
Organisation Sportunterricht:
- Wöchentlich eine Doppelstunde
- In der Regel in der Sporthalle: Dreifachhalle und Einzelhalle
- zusammen mit einer weiteren Klasse
Sportfeste und Projekte:
- Sportfestival des beruflichen Schulsports
- Beachvolleyball Turnier der beruflichen Schulen
Unterrichtsinhalte des 3. Ausbildungsjahres
| Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration | |||
|---|---|---|---|
| Lernfeld 10b | Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren | ITS12-1 | 7 UE |
| Lernfeld 11b | Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten | ITS12-2 | 7 UE |
| Lernfeld 12b | Kundenspezifische Systemintegration durchführen | ITP | 11 UE |
| Deutsch | Deutsch | DE | 3 UE |
| Englisch | Englisch | EN | 3 UE |
| Ethik | Ethik | ETH | 3 UE |
| Politik und Gesellschaft | Politik und Gesellschaft | PuG | 3 UE |
| Religion | Religion | REL | 3 UE |
| Sport | Sport | SP | 2 UE |