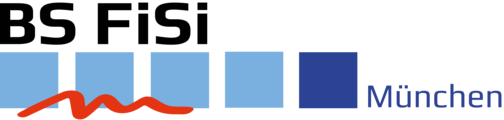zuständige Lernfeldbeauftragte: Frau Manuela Frommhold
In Lernfeld 6 vermitteln wir unseren Auszubildenden die erforderlichen Kompetenzen, um Serviceanfragen professionell zu bearbeiten. Dies umfasst den gesamten Prozess von der Aufnahme der Anfrage über die systematische Einordnung, Ermittlung möglicher Fehlerursachen und Lösungsmöglichkeiten bis hin zur begleitenden Dokumentation. Projektorientiert üben unsere Auszubildende den Umgang mit herausfordernden Gesprächssituationen. Sie erstellen auf Basis verschiedener Kommunikationsmodelle einen Leitfaden für die professionelle Kommunikation mit den Kund*innen und führen entsprechende Servicegespräche durch. Hierbei lernen sie Deeskalationsstrategien anzuwenden, um Servicegespräche kunden- und lösungsorientiert zu führen.
Die Auszubildenden
- analysieren Serviceanfragen und prüfen zugrundeliegende Service-Level-Agreements
- klassifizieren und priorisieren Serviceanfragen
- ermitteln Lösungsmöglichkeiten
- dokumentieren den Bearbeitungsstatus
- kommunizieren situationsgerecht unter Anwendung verschiedener Kommunikationstechniken
- bearbeiten englischsprachige Serviceanfragen
- leiten Maßnahmen zur Qualitätssicherung ab
zuständiger Lernfeldbeauftragter: Herr Joachim Wolf
Im Lernfeld 7 (IT-Technik) stehen industrielle Steuerungssysteme (Cyber-physische Systeme, CPS) im Mittelpunkt. Hierbei geht es uns um den Umgang und die Synergie zwischen IT-Systemen und der physischen Welt. Im Unterricht werden im Rahmen von Kundenaufträgen bestehende CPS analysiert, von den Auszubildenden um weitere Komponenten ergänzt, nach Kundenwunsch programmiert und dann in Betrieb genommen. Da CPS hochgradig auch über das Internet vernetzt sein können (Internet of Things, IoT), werden im Unterricht die wesentlichen Eigenschaften und Kommunikationsverfahren ausgewählter Komponenten des Sensor-Aktor-Netzwerks besprochen. Auch die IT-Sicherheit industrieller Steuerungssysteme (Cybersecurity) kommt nicht zu kurz. Im Unterricht werden die dazu nötigen Kompetenzen praxisnah vermittelt, indem sicherheitsrelevante Systemeinstellungen umgesetzt und Netzwerkkomponenten entsprechend konfiguriert werden.
- Zusammenführung der physischen Welt und IT-Systeme zu einem cyber-phyischen System
- Analyse eines cyber-phyischen Systems bezüglich eines Kundenauftrags zur Ergänzung und Inbetriebnahme weiterer Komponenten
- Datenfluss an der Schnittstelle zwischen physischer Welt und IT-Systemen
- Kommunikation in einem bestehenden Netzwerk
- Überblick über Energie-, Stoff- und Informationsflüsse aller am System beteiligten Geräte und Betriebsmittel
- Planung der Umsetzung des Kundenwunsches, indem Kriterien für Energieversorgung, Hardware und Software (Bibliotheken, Protokolle) aufgestellt werden
- Nutzung von Unterlagen der technischen Kommunikation und Anpassung dieser Unterlagen
- Zusammenführung der Komponenten mit dem cyber-physischen System
- Systematische Überprüfung der Funktionalität
- Messen von physikalischen Betriebswerten und die Validierung bzw. Protokollierung der Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse hinsichtlich von Betriebssicherheit und Datensicherheit
zuständiger Lernfeldbeauftragter: Herr Peter Werthan
Die Auszubildenden
- besitzen die Kompetenz, Daten aus dezentralen Quellen zusammenzuführen, aufzubereiten und zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen.
- ermitteln für einen Kundenauftrag Datenquellen und analysieren diese hinsichtlich ihrer Struktur, rechtlicher Rahmenbedingungen, Zugriffsmöglichkeiten und -mechanismen.
- wählen die Datenquellen (heterogen) für den Kundenauftrag aus.
- entwickeln Konzepte zur Bereitstellung der gewählten Datenquellen für die weitere Verarbeitung unter Beachtung der Informationssicherheit.
- implementieren arbeitsteilig, auch ortsunabhängig, ihr Konzept mit vorhandenen sowie dazu passenden Entwicklungswerkzeugen und Produkten.
- übergeben ihr Endprodukt mit Dokumentation zur Handhabung, auch in fremder Sprache, an die Kunden.
- reflektieren die Eignung der eingesetzten Entwicklungswerkzeuge hinsichtlich des arbeitsteiligen Entwicklungsprozesses und die Qualität der Dokumentation.
zuständiger Lernfeldbeauftragter: Herr Amir Gracic
Im zweiten Ausbildungsjahr vertiefen die Auszubildenden ihre bereits erworbenen netzwerktechnischen Kenntnisse, um ihr Verständnis und Fähigkeiten in der IT-Systemintegration weiter auszubauen.
Anhand realistischer Szenarien erlernen die Auszubildenden Netzwerktechnologien und Netzwerkdienste, um ein funktionierendes System aufbauen zu können. Sie lernen, wie sie mit Hilfe von virtuellen Maschinen Ressourcen optimieren, um die Effizienz von IT-Infrastrukturen steigern zu können. Des Weiteren werden Grundlagen des Cloud-Computing vermittelt, um Cloud Ressourcen bereitzustellen und zu verwalten.
Im Unterricht wird großer Wert daraufgelegt, das theoretische Wissen durch praktische Erfahrungen zu ergänzen. Daher führen die Auszubildendne im Rahmen des Unterrichts eine Serverinbetriebnahme durch und verwalten und überwachen dabei Benutzer und Ressourcen.
- Ermittlung der Anforderungen an ein Netzwerk ggf. auch mit Kommunikation in Richtung des Kunden (z.B. Welche Eigenschaften, Funktionen und Leistungsmerkmale haben Netzwerkkomponenten und Dienste?)
- Berücksichtigung von sicherheitsrelevanten Merkmalen bei Netzwerkkomponenten und Diensten (z.B. Gibt es sichere oder unsichere Dienste? Wie unterscheiden sich die Netzwerkkomponenten hinsichtlich IT-Sicherheit?)
- Die Planung von erforderlichen Diensten und die dafür notwenigen Netzwerke und deren Infrastruktur (z.B. Welche Netzwerkinfrastruktur brauchst du für ein Storage-System?)
- Berücksichtigung der Faktoren Nachhaltigkeit, technische und wirtschaftliche Eignung bei Netzwerkkonzepten (z.B Storage-Systeme in Rechenzentren mit Öko-Strom)
- Installation von Netzwerken und deren Infrastruktur sowie Diensten (z.B. Installation eines Mail-Servers oder Implementierung einer Active Directory Umgebung)
- Die Beurteilung von Netzwerken oder Netzwerkkonzepten sowie von Diensten
- Beachtung von Datenschutz und Datensicherheit sowie Anforderungen an die Netzwerke
zuständige Fachbeauftragte: Frau Kornelia Seiband
Unterrichtsinhalte 2. Ausbildungsjahr
- Teambuilding (Forming, Storming, Norming, Performing)
- Klassisches Projektmanagement - Grundlagen
- Klassisches Projektmanagement - Projektinitiierung
- Klassisches Projektmanagement – Projektplanung, -durchführung, -abschluss
- Weitere Projektmanagementmodelle (Wasserfallmodell, Spiralmodell, agiles Projektmanagement, SCRUM - Methode)
- Prozesse beschreiben
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Christian Reiner
Unterrichtsinhalte 2. Ausbildungsjahr
- Regional Studies: USA, Canada
- Trade Fairs
- Business Correspondence (Enquiry, Offer, Order, Complaint, Reminder)
- Managing an IT Network Project
- Robots, AI and the Future of Work and Learning
zuständige Fachbeauftragte: Frau Daniela Wittl
Unterrichtsinhalte 2. Ausbildungsjahr:
- Verantwortung des Einzelnen in der Gesellschaft z.B. Minderheitenschutz, Zivilcourage
- Verantwortung innerhalb einer globalen Welt, z.B. Nachhaltigkeit, Friedenssicherung
- Modelle verantwortlichen und gerechten wirtschaftlichen Handelns im Sinne von z.B. Nachhaltigkeit und Umweltschutz
- Aktuelle Themenfelder z.B. Lohngerechtigkeit, Lobbyarbeit
- Herausforderungen und Chancen der medizinischen Einflussnahme
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Dieter Metzmann
Die Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr beschäftigen sich mit den grundlegenden Werten für ein gemeinsames freiheitliches, demokratisches Zusammenleben. Dabei reflektieren sie ihre eigenen Bedürfnissen und Erwartungen an den Staat und die Gesellschaft. Sie erkennen die Notwendigkeit einer staatlichen Ordnung, um Stabilität und Schutz für alle zu gewährleisten. Der Fokus liegt auch auf der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik, unter anderem auf den Verfassungsprinzipien des Grundgesetzes. Die Auszubildenden lernen nicht nur die wesentlichen Elemente eines totalitären Staates kennen, sondern auch die gravierenden Einschränkungen und Zwänge, denen Menschen in solchen System ausgesetzt sind. Dies ermöglicht ihnen, die Unterschiede zwischen autoritären und demokratischen System zu verstehen. Im Gegenzug wird ihnen vermittelt wie wichtig die Prinzipien der liberalen Demokratie sind, besonders im Hinblick auf freie Wahlen nach den geltenden Wahlgrundsätzen. Sie sollen aktuelle Gefahren für die Demokratie erkennen und begreifen, welche Bedrohungen sie für die Gesellschaft darstellen können. Ein weitere wichtiger Aspekt ist das Verständnis für demokratische Verhaltensweisen und deren Bedeutung für das öffentliche Leben. Die Auszubildenden lernen, wie essenziell ihre aktive Partizipation in Staat und Gesellschaft ist, um die Demokratie zu bewahren und weiterzuentwickeln. Diese Auseinandersetzung hilft ihnen, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung von Demokratie und die Verantwortung als Bürger zu entwicklen.
Unterrichtsinhalte 2. Ausbildungsjahr:
- Bedeutung des Staates, Gewaltenteilung und Machtkontrolle
- Grundgesetz
- Gemeinde
- Bundesverfassungsorgane
- Gesetzgebung
- Partizipation in der Demokratie
zuständiger Fachbeauftragter ev.: Herr Günter Gottfried
Der Religionsunterricht ist ein Forum für die Fragen, Probleme und Überzeugungen der Auszubildenden. Die Loslösung vom Elternhaus, die Suche nach Orientierung und Lebenszielen sowie das Zurechtfinden in der Gesellschaft, im gewählten Beruf und in religiösen Fragen kennzeichnen die Situation der jungen Menschen während der Berufsausbildung. Im Religionsunterricht suchen sie nach Antworten und verlässlicher Orientierung.
Die Lehrkräfte greifen im Religionsunterricht persönlich bedeutsame Anliegen der Auszubildenden auf und setzen im Unterricht in pädagogischer Verantwortung entsprechende lerngruppenspezifische Schwerpunkte.
Im Zentrum des Unterrichts stehen Fragen, die das gesamte menschliche Dasein umfassen. Die Spannungsfelder menschlichen Lebens mit ihren Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen sollen reflektiert und für eine Sinn- und Handlungsorientierung an der christlichen Botschaft aufgeschlossen werden.
Die Auszubildenden entwickeln – auch in der persönlichen Auseinandersetzung mit ihrer Religionslehrkraft – individuelle, reflektierte und gegenüber anderen verantwortbare Standpunkte und Werthaltungen. Ihre sozialen Kompetenzen festigen sich in der Auseinandersetzung mit anderen Erfahrungen und Positionen innerhalb der Unterrichtsgruppe. Sie lernen eigenständiges, sinnerfassendes und vernetztes Denken, sie schulen ihre religiöse Sprach- und Ausdrucksfähigkeit und üben sich im respektvollen Umgang mit anderen Meinungen.
Der Religionsunterricht ist von einer Atmosphäre der Offenheit, des gemeinsamen Suchens und des lebendigen Gesprächs miteinander geprägt. Sein ganzheitlicher Ansatz bezieht Phasen der Stille, der Kontemplation und der Kreativität mit ein.
Unsere Schule ist Teil des Schulversuchs „StReBe“ (Stärkung des konvessionellen Religionsunterricht an Berufsschulen).
Dieser ermöglicht es, dass evangelische und katholische Auszubildende gemeinsam unterrichtet werden können und öffnet darüber hinaus den Religionsunterricht auch für Menschen anderer Religionen oder Glaubensrichtungen.
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Claus Maier (BS Info)
Profil des Unterrichtsfaches Sport
Sport gehört zu den allgemeinbildenden Fächern an beruflichen Schulen und beinhaltet eine ganzheitlich pädagogische,gesundheitliche und soziale Zielsetzung:
- Spiel und Spaß
- Ausgleich zum Berufsalltag und sitzenden Tätigkeit
- Einsicht über Belastungen und Beanspruchungen der Arbeitswelt
- Individuelles und soziales Lernen
- Schulung des kooperativen Verhaltens
- Sportliche Qualifikation als Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung
Organisation Sportunterricht:
- Wöchentlich eine Doppelstunde
- In der Regel in der Sporthalle: Dreifachhalle und Einzelhalle
- zusammen mit einer weiteren Klasse
Sportfeste und Projekte:
- Sportfestival des beruflichen Schulsports
- Beachvolleyball Turnier der beruflichen Schulen
Unterrichtsinhalte des 2. Ausbildungsjahres
| Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration | |||
|---|---|---|---|
| Lernfeld 6 | Serviceanfragen bearbeiten | BGP | 3 UE |
| Lernfeld 7 | Cyber-physische Systeme ergänzen | ITT | 6 UE |
| Lernfeld 8 | Daten systemübergreifend bereitstellen | AP | 8 UE |
| Lernfeld 9 | Netzwerke und Dienste bereitstellen | ITS | 8 UE |
| Deutsch | Deutsch | DE | 3 UE |
| Englisch | Englisch | EN | 3 UE |
| Ethik | Ethik | ETH | 3 UE |
| Politik und Gesellschaft | Politik und Gesellschaft | PuG | 3 UE |
| Religion | Religion | REL | 3 UE |
| Sport | Sport | SP | 2 UE |