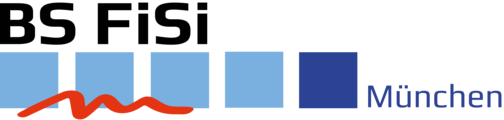zuständige Lernfeldbeauftragte: Frau Manuela Frommhold
In Lernfeld 1 unterstützen wir unsere Auszubildenden dabei, das eigene Unternehmen besser kennenzulernen und die eigene Rolle im Betrieb zu reflektieren. Hierbei lernen sie, ihr Unternehmen hinsichtlich seiner Wertschöpfungskette zu analysieren, ihre eigene Rolle im Unternehmen zu reflektieren und wirtschaftliche Prozesse einzuordnen. Zudem vermitteln wir den Auszubildenden grundlegende wirtschaftliche Kenntnisse und befähigen sie, betriebliche Zusammenhänge zu verstehen. Wir klären auch wichtige rechtliche Fragen, wie z. B. „Wer darf was im Unternehmen?“ im Zuge der Unterrichtseinheit “Vollmachten”, so dass die Auszubildenden beurteilen können, welchen Handlungs- und Entscheidungsspielraum sie haben. Auch unterstützen wir unsere Auszubildenden bei der Erstellung einer an ihre individuellen Bedürfnisse angepassten Karriereplanung. Eine wichtige Zielsetzung des Lernfelds besteht im Transfer der Lerninhalte auf das eigene Ausbildungsunternehmen. Zudem setzen die Auszubildenden das Konzept "Lernen durch Lehren" um, indem sie ihren Mitauszubildenden fachliche Inhalte vermitteln und eine Übung zur Vertiefung des Gelernten moderieren.
Die Auszubildenden
- analysieren die Aufbauorganisation und das Zielsystem ihres Unternehmens
- erkunden die Leistungsschwerpunkte ihres Unternehmens
- präsentieren ihr Unternehmen hinsichtlich seiner Wertschöpfungskette
- analysieren die Marktstruktur in ihrer Branche
- erarbeiten Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen
- informieren sich über Vollmachten
- analysieren Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
zuständige Lernfeldbeauftragte: Frau Anita Hofmeister
In Lernfeld 2 befähigen wir unsere Auszubildenden dazu, einen Arbeitsplatz nach Kundenwunsch auszustatten. Der gesamte Prozess wird vom Einkauf bis zum Verkauf sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit durchgeführt.
Großen Wert legen wir auf die praktische Erarbeitung der Inhalte, die Auszubildenden werden unter anderem:
- einen Rechner in seine Komponenten zerlegen
- Angebote vergleichen und erstellen
- eine Handelskalkulation durchführen
- Störungen des Kaufvertrages ermitteln
- Fehlermeldungen bei der Installation analysieren
- eine Übergabe protokollieren
zuständiger Lernfeldbeauftragter: Herr Amir Gracic
Das Lernfeld 3 (Fach IT-System) wird über alle 3 Ausbildungsjahre (Lernfeld 3, Lernfeld 9, Lernfeld 10b und 11b) unterrichtet.
In ITS werden mit der Vermittlung von Fachkompetenzen in System- und Netzwerktechnik die wesentlichen Inhalte der FiSi-Ausbildung unterrichtet und damit die Schwerpunkte der beruflichen Handlungsfelder der Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen in der Fachrichtung Systemintegration abgedeckt.
Im Lernfeld 3 lernen die Auszubildenden anhand von Kundenanforderungen die Integration von Clients in einer Netzwerkinfrastruktur. Dazu gehört die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme vernetzter IT-Systeme. Um die Auszubildenden optimal auf die Anforderungen des heutigen IT-Marktes vorzubereiten, besteht der Unterricht aus einer Mischung von theoretischen Konzepten und praktischen Übungen. Der Fachbereich verfügt über einen modernen Patchraum, in dem die Auszubildenden die theoretisch erlernten Inhalte praktisch umsetzen und erleben können. Dabei werden komplexe Netzwerke physisch aufgebaut, die notwendigen Netzwerkkomponenten konfiguriert und die Kommunikation in den Netzwerken getestet.
- Analyse einer Netzwerkinfrastruktur (z.B. Ist-Analyse einer vorhanden Infrastruktur)
- Integration von Clients in einer Netzwerkinfrastruktur (z.B. Wie kann ich Clients in eine vorhanden Infrastruktur einbinden?)
- Struktur und Komponenten von Netzwerken (z.B. Netzwerktopologien)
- Eigenschaften und Standards von Netzwerken (z.B. LAN, WAN, GAN etc. und IEEE 802 etc.)
- physische und logische Netzwerkpläne (physikalisch gekoppelte Netzwerke vs. logisch über Software verbundenen Netzwerke)
- Erstellung von Konzepten zur Integration von Client(s) in bestehenden Netzwerkinfrastrukturen (z.B. Wie kann ich die Client(s) integrieren?)
- Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Konfiguration von Client(s) und Einbindung der Client(s) in Netzwerke
- Prüfung der Konfiguration der Client(s) im Netzwerk und Protokollierung
zuständiger Lernfeldbeauftragter: Herr Joachim Wolf
Bei diesem Lernfeld werden wir uns hauptsächlich mit der Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich und IT-Sicherheit beschäftigen. Im Fokus steht die Sicherheitsanalyse, deren Wichtigkeit, Umsetzung, Maßnahmen und Dokumentation. Außerdem steht die Wichtigkeit und der Sinn von IT-Richtlinien von Unternehmen im Vordergrund. Des Weiteren spielen die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Form von Gesetzen und Verordnungen eine wichtige Rolle.
- Analyse und Verständnis einer Sicherheitsanalyse im Unternehmen (Warum macht ein Unternehmen eine Sicherheitsanalyse?)
- Informationssicherheit (Schutzziele) (Was sind Schutzziele und welche Beispiele gibt es?)
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Vorgaben zur Bestimmung des Schutzniveus im eigenen Arbeitsbereich (Welche Gesetzte oder Verordnungen gibt es?)
- Planung einer Schutzbedarfsanalyse (Wie wird eine Analyse gemacht?)
- Grundsätzliches Verständnis zu IT-Sicherheitsleitlinien in Unternehmen (Warum muss es IT-Richtlinien in Unternehmen geben und was ist deren Sinn?)
- Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit (Was bedeuten diese einzelnen Schutzziele und warum sind sie wichtig?)
- Umsetzung der Schutzziele in der Praxis
- Gewichtung der möglichen Bedrohungen unter Berücksichtigung der Schadensszenarien (Beispielszenarien mit entsprechender Gewichtung der Faktoren)
- Durchführung einer Schutzbedarfsanalyse (Wie wird eine Analyse durchgeführt?)
- Bedrohungsfaktoren und Dokumentation der Schutzbedarfsanalyse
- Bewerten und Vergleich der Schutzbedarfsanalyse mit IT-Sicherheitsrichtlinien der Unternehmen
- Erstellung und Empfehlung von geeigneten Maßnahmen (Welche Maßnahmen können aus der Analyse abgeleitet werden?)
zuständiger Lernfeldbeauftragter: Herr Peter Werthan
Die Auszubildenden
- verfügen über die Kompetenz, Informationen mittels Daten abzubilden, diese Daten zu verwalten und dazu Software anzupassen.
- informieren sich innerhalb eines Projektes über die Abbildung von Informationen mittels Daten. Dabei analysieren sie Daten hinsichtlich Herkunft, Art, Verfügbarkeit, Datenschutz, Datensicherheit und Speicheranforderung und berücksichtigen Datenformate und Speicherlösungen.
- planen die Anpassung einer Anwendung zur Verwaltung der Datenbestände und entwickeln Testfälle. Dabei entscheiden sie sich für ein Vorgehen.
- implementieren die Anpassung der Anwendung, auch im Team und erstellen eine Softwaredokumentation.
- testen die Funktion der Anwendung und beurteilen deren Eignung zur Bewältigung der gestellten Anforderungen.
- evaluieren den Prozess der Softwareentwicklung.
zuständige Fachbeauftragte: Frau Kornelia Seiband
Im Deutschunterricht sollen die Schüler*innen ihre schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit weiterentwickeln und den Zusammenhang zwischen sprachlichem Handeln, sozialem Verhalten und beruflichen Erfolg erkennen. Der Deutschunterricht soll sie befähigen, sich kritisch mit Themen und Medien aus dem eigenen Erfahrungs- und Interessensbereich sowie aus dem Bereich der beruflichen Praxis auseinanderzusetzen.
Für die Herausforderungen am Arbeitsplatz erwerben Sie wertvolle Schlüsselqualifikationen, wie z.B. vernetztes Denken, Kooperations-, Team- und Konfliktfähigkeit.
Dabei werden sprachliche Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die den Auszubildenden helfen Kommunikationssituationen sach-, situations- und adressatengerecht zu bewältigen. Zusätzlich wird die Allgemeinbildung gestärkt und durch den Umgang mit Sprache zur Teilnahme am kulturellen Leben angeregt.
Unterrichtsinhalte 1. Ausbildungsjahr
- Präsentationstechnik (Feedback geben, Kriterien einer Präsentation)
- Ergonomie am Arbeitsplatz“ (Überblick, ausgewählte Bereiche für ergonomische Berücksichtigung, Prüf- und Gütesiegelsiegel)
- Anwendung der Präsentationstechniken (Präsentation der ausgewählten Bereiche für „Ergonomie am Arbeitsplatz“
- Kommunikation (Situationsanalyse, verbale und nonverbale Kommunikation, Kommunikationsmodelle
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Christian Reiner
Weshalb Englisch an der Berufsschule?
Die englische Sprache ist eines der wichtigsten Kommunikationsmittel im internationalen Austausch. Daher ist es für immer mehr Arbeitskräfte wichtig, über ausreichend berufsbezogene Englischkenntnisse (Business English/Technical English) zu verfügen, um auch in einem internationalen Arbeitsumfeld bestehen zu können (Globalisierung).
Der Englisch-Unterricht der Berufsschule soll auf den bereits zuvor erworbenen Englisch-Kenntnissen aufbauen und diese vertiefen. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Vermittlung von berufsbezogenen Englsich-Kenntnissen und Fertigkeiten (z. B. das verfassen von englischer Geschäftskorrespondenz oder das fachgespräch über die Installation eines IT-Netzwerks) und dem dafür nötigen Fachvokabular liegen.
Unsere Auszubildenden sollen am Ende der Ausbildung in der Lage sein, die an der Berufsschule erworbenen Sprachkenntnisse bei Bedarf zukünftig auch eigenständig zu erweitern (selbstgesteuertes lebenslanges Lernen). Darüber hinaus haben die Auszubildenden auch die Möglichkeit das KMK-Englischzertifikat zu erwerben oder am Erasmus-Austausch-Programm teilzunehmen.
Unterrichtsinhalte 1. Ausbildungsjahr:
- Regional Studies: United Kingdom Ireland
- Exploring an IT Company (Organisational Structure)
- Working at an IT Company
- Computer Hardware and Software
- (Telephoning, Email Writing, Making Appointments, Meeting Customers/Visitors)
zuständige Fachbeauftragte: Frau Daniela Wittl
Unterrichtsinhalte 1. Ausbildungsjahr:
- Ethische Fachbegriffe „Werte“, „Normen“, Identität“
- Werte: materiell, ideell; Wertewandel; Wertekonflikte
- Zentrale Aussagen der Weltreligionen
- Technik im Wandel der Zeit
- Ethikkodizes
- Aktuelle Themenfelder: z.B. Energiegewinnung, Entsorgung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit in Produktion und Konsum
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Dieter Metzmann
Im ersten Ausbildungsjahr werden die Auszubildenden darin befähigt werden, die Bedeutung des Sozialversicherungssystem sowohl für ihre eigene Zukunft als auch für die Gesellschaft zu erkennen. Sie entwickeln ein Verantwortungsbewusstsein für das System und gewinnen ein Verständnis dafür, wie wichtig die kontinuierliche Anpassung dieses Systems ist. Darüber hinaus wird den Auszubildenden bewusst gemacht, dass Leistungen, die über die Grundversorgung hinausgehen, durch individuelle Vorsorge abgesichert werden müssen. Ein weitere Schwerpunkt liegt auf dem Wandel der Arbeitswelt und den damit verbundenen individuellen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Auszubildenden erkennen die allgemeine Bedeutung von Erwerbsarbeit und die Rolle, die sie selbst dabei spielen. Zudem erhalten sie einen vertieften Einblick in die Grundlagen der Berufsausbildung sowie in arbeitsrechtliche und tarifvertragliche Regelungen, die für ihre zukünftige berufliche Laufbahn von Bedeutung sind.
Unterrichtsinhalte 1. Ausbildungsjahr:
- duale Ausbildung und Berufsausbildungsvertrag
- Arbeitsvertrag, Kündigung und Schutzbestimmung
- Gesellschaftliche Interessenverbände (Tarifvertrag, Tarif- und Sozialpartner)
- Betriebsverfassungsrecht
- Soziale Sicherung durch Sozialversicherungen
- Individualversicherung
zuständiger Fachbeauftragter ev.: Herr Günter Gottfried
Der Religionsunterricht ist ein Forum für die Fragen, Probleme und Überzeugungen der Auszubildenden. Die Loslösung vom Elternhaus, die Suche nach Orientierung und Lebenszielen sowie das Zurechtfinden in der Gesellschaft, im gewählten Beruf und in religiösen Fragen kennzeichnen die Situation der jungen Menschen während der Berufsausbildung. Im Religionsunterricht suchen sie nach Antworten und verlässlicher Orientierung.
Die Lehrkräfte greifen im Religionsunterricht persönlich bedeutsame Anliegen der Auszubildenden auf und setzen im Unterricht in pädagogischer Verantwortung entsprechende lerngruppenspezifische Schwerpunkte.
Im Zentrum des Unterrichts stehen Fragen, die das gesamte menschliche Dasein umfassen. Die Spannungsfelder menschlichen Lebens mit ihren Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen sollen reflektiert und für eine Sinn- und Handlungsorientierung an der christlichen Botschaft aufgeschlossen werden.
Die Auszubildenden entwickeln – auch in der persönlichen Auseinandersetzung mit ihrer Religionslehrkraft – individuelle, reflektierte und gegenüber anderen verantwortbare Standpunkte und Werthaltungen. Ihre sozialen Kompetenzen festigen sich in der Auseinandersetzung mit anderen Erfahrungen und Positionen innerhalb der Unterrichtsgruppe. Sie lernen eigenständiges, sinnerfassendes und vernetztes Denken, sie schulen ihre religiöse Sprach- und Ausdrucksfähigkeit und üben sich im respektvollen Umgang mit anderen Meinungen.
Der Religionsunterricht ist von einer Atmosphäre der Offenheit, des gemeinsamen Suchens und des lebendigen Gesprächs miteinander geprägt. Sein ganzheitlicher Ansatz bezieht Phasen der Stille, der Kontemplation und der Kreativität mit ein.
Unsere Schule ist Teil des Schulversuchs „StReBe“ (Stärkung des konvessionellen Religionsunterricht an Berufsschulen).
Dieser ermöglicht es, dass evangelische und katholische Auszubildende gemeinsam unterrichtet werden können und öffnet darüber hinaus den Religionsunterricht auch für Menschen anderer Religionen oder Glaubensrichtungen.
zuständiger Fachbeauftragter: Herr Claus Maier (BS Info)
Profil des Unterrichtsfaches Sport
Sport gehört zu den allgemeinbildenden Fächern an beruflichen Schulen und beinhaltet eine ganzheitlich pädagogische,gesundheitliche und soziale Zielsetzung:
- Spiel und Spaß
- Ausgleich zum Berufsalltag und sitzenden Tätigkeit
- Einsicht über Belastungen und Beanspruchungen der Arbeitswelt
- Individuelles und soziales Lernen
- Schulung des kooperativen Verhaltens
- Sportliche Qualifikation als Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung
Organisation Sportunterricht:
- Wöchentlich eine Doppelstunde
- In der Regel in der Sporthalle: Dreifachhalle und Einzelhalle
- zusammen mit einer weiteren Klasse
Sportfeste und Projekte:
- Sportfestival des beruflichen Schulsports
- Beachvolleyball Turnier der beruflichen Schulen
Unterrichtsinhalte des 1. Ausbildungsjahres
| Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration | |||
|---|---|---|---|
| Lernfeld 1 | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben | BGP | 3 UE |
| Lernfeld 2 | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten | ITT-10-1 | 6 UE |
| Lernfeld 3 | Clients in Netzwerke einbinden | ITS | 7 UE |
| Lernfeld 4 | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen | ITT-10-2 | 3 UE |
| Lernfeld 5 | Software zur Verwaltung von Daten anpassen | AP | 6 UE |
| Deutsch | Deutsch | DE | 3 UE |
| Englisch | Englisch | EN | 3 UE |
| Ethik | Ethik | ETH | 3 UE |
| Politik und Gesellschaft | Politik und Gesellschaft | PuG | 3 UE |
| Religion | Religion | REL | 3 UE |
| Sport | Sport | SP | 2 UE |